Tiere zählen gehört dazu: Wenn wir Naturschutzarbeit machen, wollen wir auch messen, ob unsere Arbeit tatsächlich Erfolg hat. Dafür müssen wir abschätzen, ob die bedrohten Arten, deren Lebensräume wir schützen und deren Wilderei wir bekämpfen, auch tatsächlich mehr werden. Aber wie viele Tiere von einer Art leben denn nun in einem Gebiet? Diese Frage klingt erst einmal einfach, ist aber oft schwierig zu beantworten.
Die besonderen Wälder Kambodschas
Wie schon berichtet, arbeiten wir in Kambodscha zum Erhalt der großen Trockenwälder im Nordosten des Landes. In diesen einzigartigen Tropenwäldern leben zahlreiche bedrohte und besondere Arten — darunter Leoparden, Wildrinder und Leierhirsche, sowie Asiatische Elefanten und verschiedene Arten großer Wasservögel. Aber die Wälder sind weitläufig und die scheuen Tiere sieht man nur äußerst selten. Deswegen muss man ein paar Tricks benutzen, um herauszufinden, wie viele Tiere es von jeder Art gibt. Beim WWF nutzen wir verschiedene Methoden, um die Tiere in unseren Gebieten zu zählen.
1. Tier zählen mit Kamerafallen: Und es macht „klick“

Besonders bekannt sind natürlich die Kamerafallen, die wir aufhängen, damit sie automatisch vorbeikommende Tiere fotografieren. Die Kameras können uns sagen, welche Arten in einem Gebiet überhaupt vorkommen, weil sie auch scheue Arten ohne Störung ablichten. Und bei Tieren, die man auf Fotos individuell unterscheiden kann, helfen Kamerafallen diese Tiere zu zählen. Zum Beispiel bei Leoparden anhand ihrer Punkte auf dem Fell. Dann kann man mit komplizierten statistischen Methoden berechnen, wie viele Leoparden es in einem Gebiet gibt. In Kambodschas Eastern Plains Landscape leben zum Beispiel auf jeweils 100 Quadratkilometern etwa drei bis vier Leoparden. Das macht insgesamt weniger als 20 Tiere in den beiden Schutzgebieten! Diese eindrucksvollen Großkatzen brauchen also dringend unseren Schutz vor Wilderei durch intensive Patrouillenarbeit vor Ort.
2. Linientransekte: Tiere zählen zu Fuß und mit dem bloßen Auge

Schwieriger wird es mit dem Zählen, wenn man die Tiere nicht an ihrem Äußeren individuell unterscheiden kann, zum Beispiel bei Wildschweinen oder Wildrindern. Eine Methode, die wir beim WWF dann nutzen, sind sogenannte „Linientransekte“. Dabei laufen Menschen entlang vorher bestimmten Linien durch das Gebiet und notieren: Welche Tierarten haben sie gesehen und wie viele? Wie weit waren diese Tiere von der vorher definierten Linie entfernt? Aus diesen Daten kann man abschätzen, wie viele Tiere es von einer Art im Gebiet gibt. Allerdings braucht man dafür viele, weit verteilte derartige „Linien“, was die Methode relativ aufwändig macht. Aber der Aufwand lohnt sich: Mit Hilfe von Linientransekten konnte der WWF zum Beispiel zeigen, dass in der Eastern Plains Landscape mehr als
2500 Banteng leben – die größte Population weltweit
dieses seltenen Wildrindes.
3. Tiere zählen durch Spurensuche: Wie im Krimi

Leider lassen sich mit Linientransekten nur häufige Tiere zählen, weil man für die Auswertung der Daten eine gewisse Menge an Beobachtungen braucht. Man muss die Tiere also oft genug sehen, wenn man die „Linien“ abläuft. Wie zählt man also menschenscheue oder besonders seltene Arten, die man kaum einmal zu Gesicht bekommt? Oft verlässt man sich auf Spuren und sonstige Hinterlassenschaften der Tiere. Bei Elefanten zum Beispiel kann man Kotproben sammeln und die DNA in diesen Kotproben analysieren. In Kambodschas Eastern Plains Landscape konnten wir durch solche Untersuchungen zeigen, dass dort noch etwa 140 Asiatische Elefanten leben. Damit ist die Region Heimat der größten Elefanten-Population in ganz Kambodscha, Laos und Vietnam!
Wie immer man Tiere zählt: Für mich bleibt es faszinierend zu erfahren, welche Arten noch in unseren Schutzgebieten leben und wie es diesen Arten dort geht. Aber wenn ich solche Zählergebnisse lese, denke ich nicht nur an die Tiere selbst, sondern auch an die Ranger und Naturschutz-Kollegen vor Ort. Denn nur durch deren harte Arbeit, tage- und wochenlang durch die Gebiete zu fahren und zu laufen, kommen wir überhaupt an dieses Wissen.





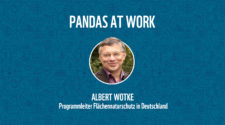
Kein Kommentar